 Mittelschullehrer Hubertus Jessel
(1915-2008) zähmte wilde Klassenjungs
(bei uns 24) – die Klassenmädchen (bei uns 6) waren nicht wild –
mit klaren Worten und Ansagen, vor allem mit klaren Aufgaben, so, wie diese eine ist: Allkameradschaftliche
Gemeinschaftsarbeit mit Vorstellung am Strand zum Festjahr „Wenningstedt 1859-1959“.
Mittelschullehrer Hubertus Jessel
(1915-2008) zähmte wilde Klassenjungs
(bei uns 24) – die Klassenmädchen (bei uns 6) waren nicht wild –
mit klaren Worten und Ansagen, vor allem mit klaren Aufgaben, so, wie diese eine ist: Allkameradschaftliche
Gemeinschaftsarbeit mit Vorstellung am Strand zum Festjahr „Wenningstedt 1859-1959“.
Und wen können wir hier
sehen: Klaus Möller, Jürgen Emig, Reinhard Manko, Peter Voss, Manfred Zikowski, Karl Dabelstein, Bernhard Ipsen,
Peter Thies Clemenz, Adolf Matzkus, Asmus Paulsen, Rolf Meyerhoff, ?, Erich Andersen, Dieter Tonn, Elke Gantzel, Sylta Schönfeld,
Jenny Habeck, Heinke Wenzel, Ingid Kuhring.
 Mittelschullehrer
Reinhard Breckwoldt (1904-1956) zeichnete eine große Nachsichtigkeit
gegenüber renitenten Schülern aus, es sei denn, sie
wollten die weit gesteckte Grenz- überschreitungslinie auf
den letzten Meter erreichen. Seine Gutmütigkeit wurde hin
und wieder von bösen Halbstarkbuben versuchsweise missbraucht,
um ihn in eine peinlich werdende Falle laufen zu lassen. War
man friedlich gesonnen, machte Musik, verhielt sich in der Öffentlichkeit
anständig, so kamen ihm Bezeichnungen wie „Dunkelmänner“
und „Eckensteher“ nicht in den Sinn, außer, wenn
man gerade eine „Spelunke“ oder „Bierkneipe“
verließ. Er war unser Klassenlehrer, lehrte uns Mathematik, Physik
und Chemie. Im nördlichen Trakt des Schulgebäudes wohnte
er mit seiner Familie, unmittelbar an einer Straße gelegen, die
infolge Zunahme des Autoverkehrs verbreitert worden war.
Das wurde ihm zum tödlichen Verhängnis. Eines Tages
eilte er aus seiner Haustür und die vorhandenen drei Stufen
hinunter und geriet vor ein herannahendes Kraftfahrzeug. Bei allen Menschen, die
davon hörten, oder die es in der Zeitung lasen und die seine lautere Persönlichkeit
wertschätzten, stellte sich Trauer ein.
Mittelschullehrer
Reinhard Breckwoldt (1904-1956) zeichnete eine große Nachsichtigkeit
gegenüber renitenten Schülern aus, es sei denn, sie
wollten die weit gesteckte Grenz- überschreitungslinie auf
den letzten Meter erreichen. Seine Gutmütigkeit wurde hin
und wieder von bösen Halbstarkbuben versuchsweise missbraucht,
um ihn in eine peinlich werdende Falle laufen zu lassen. War
man friedlich gesonnen, machte Musik, verhielt sich in der Öffentlichkeit
anständig, so kamen ihm Bezeichnungen wie „Dunkelmänner“
und „Eckensteher“ nicht in den Sinn, außer, wenn
man gerade eine „Spelunke“ oder „Bierkneipe“
verließ. Er war unser Klassenlehrer, lehrte uns Mathematik, Physik
und Chemie. Im nördlichen Trakt des Schulgebäudes wohnte
er mit seiner Familie, unmittelbar an einer Straße gelegen, die
infolge Zunahme des Autoverkehrs verbreitert worden war.
Das wurde ihm zum tödlichen Verhängnis. Eines Tages
eilte er aus seiner Haustür und die vorhandenen drei Stufen
hinunter und geriet vor ein herannahendes Kraftfahrzeug. Bei allen Menschen, die
davon hörten, oder die es in der Zeitung lasen und die seine lautere Persönlichkeit
wertschätzten, stellte sich Trauer ein.
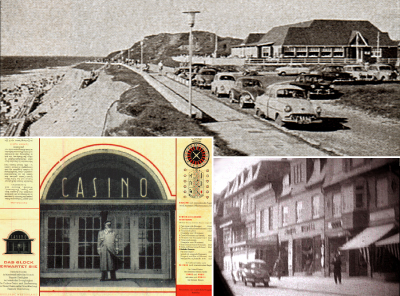 Eine gewichtige
Person namens Sanio wachte vor dem Portal des Spielcasinos in
uniformartiger Livree. Niemand Unwürdiges kam casinoeinwärts
an ihm vorbei. Gut, dann eben nicht – man konnte ja auch
die autobefahrene Friedrichstraße entlang schlendern. Ecke
Maybachstraße gab es Gustav Wilkes Drogeriefiliale. Das Hauptgeschäft
lag an der Strandstraße, von wo aus ich – bevor die
nicht nur geliebten Hausaufgaben angegangen wurden und auch,
um mir ein kleines Geld zu verdienen – auf Order des betagten
Chefs Kisten und Kasten per Sackkarre zur Filiale schob und beim
weißbekittelten Drogistensohn ablieferte. Friedrichstraßenaufwärts
standen beidseitig gemütlich wirkende Geschäftshäuser,
erst in Höhe Promenade waren von Mittelherbst bis Mittelfrühjahr
viele Schaufenster mit starken Brettern vernagelt – kaum
wegen schlimmer Kerle, aber doch wegen schlimmer Stürme.
Dann konnten einem auf den Straßen salzigweißgelbe Schaumfetzen
um die Ohren fliegen. Nicht jede unvernagelte Fensterscheibe
hielt starken Sturmböen stand. Oft ließ auch die Kraft
der Brandungsbrecher in wenigen Stunden viele Kubikmeter Kliffsubstanz
abstürzen. Seit langem schon kann man aus einem der Westfenster
des Gebäudes oben auf dem Kliff geradenwegs 15 Meter tief
auf den Sandstrand springen – solange es dieses Gebäude denn
überhaupt noch gibt.
Eine gewichtige
Person namens Sanio wachte vor dem Portal des Spielcasinos in
uniformartiger Livree. Niemand Unwürdiges kam casinoeinwärts
an ihm vorbei. Gut, dann eben nicht – man konnte ja auch
die autobefahrene Friedrichstraße entlang schlendern. Ecke
Maybachstraße gab es Gustav Wilkes Drogeriefiliale. Das Hauptgeschäft
lag an der Strandstraße, von wo aus ich – bevor die
nicht nur geliebten Hausaufgaben angegangen wurden und auch,
um mir ein kleines Geld zu verdienen – auf Order des betagten
Chefs Kisten und Kasten per Sackkarre zur Filiale schob und beim
weißbekittelten Drogistensohn ablieferte. Friedrichstraßenaufwärts
standen beidseitig gemütlich wirkende Geschäftshäuser,
erst in Höhe Promenade waren von Mittelherbst bis Mittelfrühjahr
viele Schaufenster mit starken Brettern vernagelt – kaum
wegen schlimmer Kerle, aber doch wegen schlimmer Stürme.
Dann konnten einem auf den Straßen salzigweißgelbe Schaumfetzen
um die Ohren fliegen. Nicht jede unvernagelte Fensterscheibe
hielt starken Sturmböen stand. Oft ließ auch die Kraft
der Brandungsbrecher in wenigen Stunden viele Kubikmeter Kliffsubstanz
abstürzen. Seit langem schon kann man aus einem der Westfenster
des Gebäudes oben auf dem Kliff geradenwegs 15 Meter tief
auf den Sandstrand springen – solange es dieses Gebäude denn
überhaupt noch gibt.
 Günter Schröter,
geboren in Schleiz/Thüringen, während des Krieges als
U-Boot-Funkoffizier verpflichtet, aus 30 m Ärmelkanaltiefe
unter britischem Ortungsbeschuss einzeln notauftauchend (was
nicht jedes Besatzungsmitglied überlebte), Radio- und Fernsehtechniker- meister,
bei dem ich Ende 1959 meine zweite Lehre antrat – Günter Schröter also
war ein nervös-sensibler, reell und real denkender, ehrenhafter Mann mit dem Werkstatt-Motto Erst
Gehirn einschalten, dann handeln. Die Schallplattenbar mit
der sympathischen Reihe junger kompetenter Berater- und Verkäuferinnen
unterstand Ehefrau Wera, geb. Klein aus List. Antennenbau, Verkauf,
Reparatur und Instandhaltung aller möglichen Groß-
und Kleingeräte, dazu das Abliefern von neuen oder reparierten Fernsehgeräten
und Kombitruhen bei Normalbürgern oder wohlhabenden, manchmal knickrigen,
manchmal trinkgeldspendablen Hausbesitzern in Kampen und anderswo gehörte
zur Arbeit des reichlich angestellten technischen
Personals. Auch kamen ins Geschäft, mehr noch in die Schallplattenbar
viele illustre zeitgenössische Gesangs- und andere Künstler
aus allen bundesdeutschen Ländern und weit darüber
hinaus, auch, um sich zu erkundigen, wie hoch ihr Kurs steht im Glauben, dass der
an Verkaufszahlen einzuschätzen war.
Günter Schröter,
geboren in Schleiz/Thüringen, während des Krieges als
U-Boot-Funkoffizier verpflichtet, aus 30 m Ärmelkanaltiefe
unter britischem Ortungsbeschuss einzeln notauftauchend (was
nicht jedes Besatzungsmitglied überlebte), Radio- und Fernsehtechniker- meister,
bei dem ich Ende 1959 meine zweite Lehre antrat – Günter Schröter also
war ein nervös-sensibler, reell und real denkender, ehrenhafter Mann mit dem Werkstatt-Motto Erst
Gehirn einschalten, dann handeln. Die Schallplattenbar mit
der sympathischen Reihe junger kompetenter Berater- und Verkäuferinnen
unterstand Ehefrau Wera, geb. Klein aus List. Antennenbau, Verkauf,
Reparatur und Instandhaltung aller möglichen Groß-
und Kleingeräte, dazu das Abliefern von neuen oder reparierten Fernsehgeräten
und Kombitruhen bei Normalbürgern oder wohlhabenden, manchmal knickrigen,
manchmal trinkgeldspendablen Hausbesitzern in Kampen und anderswo gehörte
zur Arbeit des reichlich angestellten technischen
Personals. Auch kamen ins Geschäft, mehr noch in die Schallplattenbar
viele illustre zeitgenössische Gesangs- und andere Künstler
aus allen bundesdeutschen Ländern und weit darüber
hinaus, auch, um sich zu erkundigen, wie hoch ihr Kurs steht im Glauben, dass der
an Verkaufszahlen einzuschätzen war.
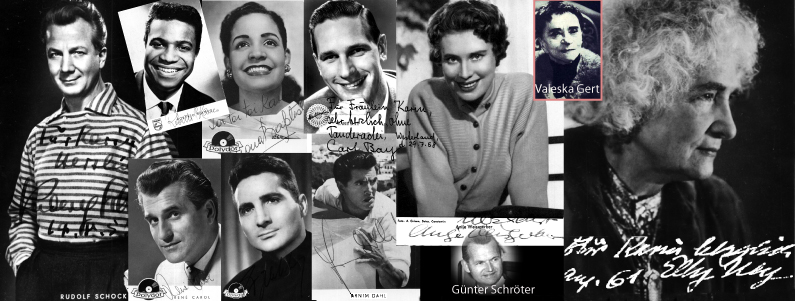 Allerlei zeitgenössische
Künstler der Instrumental- und Vokalmusik, der Pantomime,
des Sports, Schauspiels, Films, des Fernseh- und Hörfunks, so
manche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Industrie gehörten
zum großen insularen Kundschaftskreis dieses Radio- und
Musikhauses Günter Schröter an der Friedrichstraße.
Besondere Begegnungen beschreibe ich im autobiografisch durchsetzten
Roman „Kein verschwendetes Jahr“, wobei jene mit
Valeska Gert in ihrem Kampener „Ziegenstall“ für
mich die prägnanteste war, einmal Gert Fröbe dabei.
Warum erwähne ich das? Nun, weil es diese
Menschen gab und weil es in Kampen die Whisky-Straße gab
und Starmixer Karlchen Rosenzweig (Elternhaus an der
Westerländer Bastianstraße) und Manne Pahl und Werner Höfer
(zuerst in Wenningstedt bei Frau Erdmann in ihrem Hotel)
und Riecks „Kupferkanne“ mit dem Kellergewölbe-Kuschellokal
und die Ententanz-Zeit im „Pony“ mit Lilly Blessmann,
von der Freddy Quinn behauptete, sie sei (nur) seine Managerin,
und weil es einem arabischen Ölscheich in Verantwortung
gegenüber den zahlreich eingeladenen Party-Gästen in
seinem Strohdach-Palast am späten Abend nicht gelang, den
Zehnerstapel Langspielplatten im gestern gelieferten neuen Kombi-Schrank
zu wenden mit der Folge eines Notanrufs, der mich erreichte,
weil an just diesem Tag ich laut Plan an der Reihe war, ich also
nach Kampen fuhr und die Angelegenheit klärte plus Einweisungswiederholung,
verabschiedet vom Palastbesitzer mit einem Brief, in dem sich
als Ergänzung seiner Dankesworte einige Geldscheine befanden,
deren Wert sich stark der Hälfte eines monatlichen Gesellengehalts
näherte. Langer Satz, aber auch beeindruckender Inhalt.
Allerlei zeitgenössische
Künstler der Instrumental- und Vokalmusik, der Pantomime,
des Sports, Schauspiels, Films, des Fernseh- und Hörfunks, so
manche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Industrie gehörten
zum großen insularen Kundschaftskreis dieses Radio- und
Musikhauses Günter Schröter an der Friedrichstraße.
Besondere Begegnungen beschreibe ich im autobiografisch durchsetzten
Roman „Kein verschwendetes Jahr“, wobei jene mit
Valeska Gert in ihrem Kampener „Ziegenstall“ für
mich die prägnanteste war, einmal Gert Fröbe dabei.
Warum erwähne ich das? Nun, weil es diese
Menschen gab und weil es in Kampen die Whisky-Straße gab
und Starmixer Karlchen Rosenzweig (Elternhaus an der
Westerländer Bastianstraße) und Manne Pahl und Werner Höfer
(zuerst in Wenningstedt bei Frau Erdmann in ihrem Hotel)
und Riecks „Kupferkanne“ mit dem Kellergewölbe-Kuschellokal
und die Ententanz-Zeit im „Pony“ mit Lilly Blessmann,
von der Freddy Quinn behauptete, sie sei (nur) seine Managerin,
und weil es einem arabischen Ölscheich in Verantwortung
gegenüber den zahlreich eingeladenen Party-Gästen in
seinem Strohdach-Palast am späten Abend nicht gelang, den
Zehnerstapel Langspielplatten im gestern gelieferten neuen Kombi-Schrank
zu wenden mit der Folge eines Notanrufs, der mich erreichte,
weil an just diesem Tag ich laut Plan an der Reihe war, ich also
nach Kampen fuhr und die Angelegenheit klärte plus Einweisungswiederholung,
verabschiedet vom Palastbesitzer mit einem Brief, in dem sich
als Ergänzung seiner Dankesworte einige Geldscheine befanden,
deren Wert sich stark der Hälfte eines monatlichen Gesellengehalts
näherte. Langer Satz, aber auch beeindruckender Inhalt.